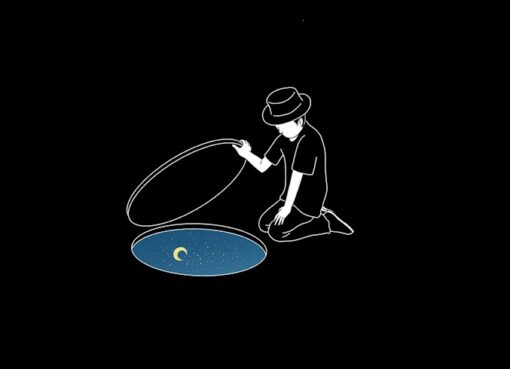Am 9. November 2018 wurde der Opfer der Opfer der Reichspogromnacht von 1938 gedacht. Am Gedenkstein in der Konrad-Wolf-Straße 91-92 (13055 Berlin) wurde ein Blumengebinde niedergelegt. Hier befand sich einst die kleine Synagoge der jüdischen Gemeinde Hohenschönhausen. Die Historikerin Barbara Danckwortt hielt die Gedenkrede, die hier im Wortlaut dokumentiert wird.
Barbara Danckwortt: Gedenkrede zur 80. Jahrestag der Reichspogromnacht
9.11.2018 am Gedenkstein Synagoge Konrad Wolf-Strasse 91-92
„Ich darf sie alle herzlich begrüßen. Ich freue mich besonders, dass so viele Jugendliche erschienen sind..
Gehen wir zurück in die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Im Alten Rathaus in München versammelten sich die Reichsgauleiter und SA-Führer. Anwesend war auch Hitler und Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Die Nachricht vom Tod des Gesandten Ernst vom Rath traf ein. Auf diesen war in Paris ein Attentat des Juden Herschel Grynszpan verübt worden. Er wollte damit ein Zeichen gegen die Zwangsdeportationen polnischer Juden aus Deutschland, darunter auch seine Eltern und Geschwister, setzen. Goebbels nahm die Nachricht vom Tode Ernst vom Raths als Anlass, eine flammende Rede zu halten. Die anwesenden Gauleiter und SA-Führer verstanden dies als unmissverständliche Aufforderung, umgehend reichsweite antisemitische Aktionen durchzuführen.
Noch in der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden jüdische Geschäfte zerstört und geplündert, – wegen der Scherben auf den Bürgersteigen wurde sie im Volksmund daher „Reichskristallnacht genannt – über 1400 Synagogen brannten.
Die Synagoge der jüdischen Gemeinde von Hohenschönhausen, an deren Stelle wir stehen, wurde übrigens nicht angezündet. Der Gebetssaal lag im ersten Stock und bot Platz für 30-50 Gläubige. Er war von Werkstattgebäuden umgeben. Diese Synagogen sollten nicht angezündet werden. Die Synagoge in der Frankfurter Allee 189 der jüdischen Gemeinde Lichtenberg aber wurde geplündert, die Thorarollen verbrannt. Dies ist für die Synagoge in Hohenschönhausen nicht überliefert. Sie wurde aber in Folge der Reichspogromnacht von der jüdischen Gemeinde aufgegeben.
Anders als von der NS-Propaganda propagiert, waren die Ausschreitungen nicht die Folge spontaner Volksempörung, sondern organisiert und von SA und SS ausgeführt. Die Feuerwehr hatte die Anweisung sich zurückzuhalten.
Anders als von der NS-Führung erwartet, stieß die Reichspogromnacht auf Empörung und Ablehnung in der Bevölkerung. In Folge wurde die Judenverfolgung zur „Geheimen Reichssache“ erklärt.
Viele empörten sich über die zerstörten Werte. Hermann Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan, nahm dies zum Anlass, die Zerstörungen den Juden anzulasten und verlangte eine sogenannte „Sühneleistung“ in Höhe von 1 Milliarde Reichsmark. In Folge wurden zahlreiche Verordnungen zum Ausschluss der Juden aus dem Wirtschaftsleben erlassen. Fast alle jüdischen Organisationen wurden aufgelöst, die jüdische Presse verboten.
Zahlreiche Protestnoten ausländischer Vertretungen gingen beim Auswärtigen Amt ein. Die Pogromnacht führte der Weltöffentlichkeit vor Augen, wie schutzlos die Juden im „Deutschen Reich“ waren. Die britische Regierung bewegte sie, ihre Einwanderungspolitik zu verändern. Sie erklärte sich bereit, tausende jüdische Kinder aus Deutschland aufzunehmen. Dies war der Beginn der Kindertransporte nach Großbritannien. Die Kinder waren zwar gerettet, aber für die Eltern war es schwer, sich von ihnen zu trennen. Viele Kinder sahen ihre Eltern, die in den Vernichtungslager ermordet wurden, nie wieder.
Für die Juden hatte die Reichspogromnacht schwerwiegende Folgen. Nicht nur, dass die Geschäfte zerstört waren und die Synagogen verbrannt, es kam zu zahlreichen gewalttätigen Übergriffen teilweise mit Todesfolge.
Schon am 10. November morgens begannen die Verhaftungen von etwa 30.000 jüdischen Männern und Jugendlichen und ihre Verschleppung in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau. Wer sich auf dem Gelände des Lagers Sachsenhausen auskennt, auf dem hinteren Gelände, wo heute die Baracken 38 und 39 noch stehen, wurde ein eigenes Lager für die „Novemberpogromjuden“ errichtet. Gestern Abend wurde im Berliner Abgeordneten-Haus eine Ausstellung in Gedenken an diese Juden feierlich eröffnet. Sie ist noch bis zum 30. November zu sehen.
Zu dieser Zeit bot sich noch die Möglichkeit zur Emigration, da die NS-Führung noch die Devise hatte, möglichst viele Juden ins Ausland zu vertreiben. Aber eine Emigration war schwierig. Es musste ein Aufnahmeland und Bürgen gefunden werden, die Auswanderung war kostspielig und zudem musste die horrende „Reichsfluchtsteuer“ bezahlt werden. Dies war also nur vermögenden Juden möglich, verarmte Juden hatten keine Chance auf eine Emigration.
Ab Herbst 1941 rollten die Deportationszüge in die Gettos wie Lodz, Riga, Reval, Theresienstadt u.a. und in das Vernichtungslager Auschwitz. Hierunter waren auch viele Juden aus Hohenschönhausen und aus anderen Ortsteilen von Lichtenberg. Kaum jemand überlebte die Deportationen. Auch dieser Menschen wollen wir heute gedenken.
Darunter war der beliebte Arzt Victor Aronstein, der seine Praxis in Hohenschönhausen hatte. Er wurde im November 1941 mit seiner Freundin, seiner späteren Frau, ins Ghetto Lodz deportiert. Sein Geld hatte er zuvor seinen Schwestern und Schwagern für ihre Auswanderung nach Chile gegeben. Für seine Mitreise reichte sein Geld nicht mehr aus. Verzweifelt wartete er auf eine Auswanderung in die USA, aber die Papiere trafen nicht mehr rechtzeitig ein, bevor er die Deportationsanweisung ins Ghetto Lodz erhielt. Er wurde in Auschwitz ermordet.
Ich möchte sie bitten, gegen den aktuellen Rassismus eine klare Gegenstimme zu erheben, in ihrem Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz oder sogar in der eigenen Familie.
Ein Talmudspruch lautet „Wer auch immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte.“
Auch sie können sich einsetzen. Im Internet sind öfters Aufrufe, sich für Menschen einzusetzen, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen, darunter auch Kinder und Jugendliche. Suchen Sie sich ihren Menschen aus, den sie unterstützen möchten oder spenden sie für einen Stolperstein.
Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.“